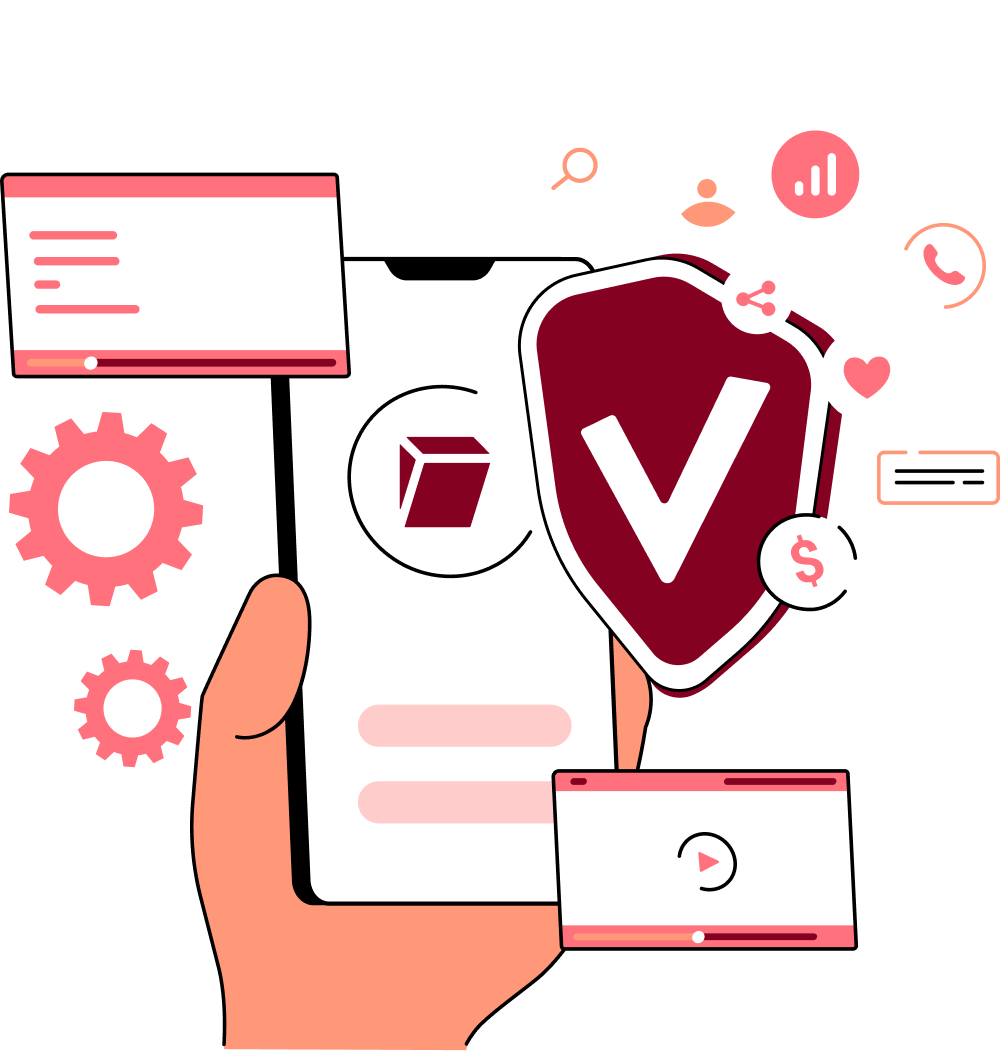Feiern wir den Tag der Deutschen Einheit - und nehmen wir ihn als Mahnung, die Chatkontrolle zu stoppen!
Die Teilung Deutschlands wurde von Massenüberwachung in Ostdeutschland und der Unterdrückung der Opposition begleitet. Dies sollte uns als Lehre dienen, warum Chatkontrolle niemals zugelassen werden darf.
Die Teilung Deutschlands ging mit einer Massenüberwachung in Ostdeutschland und der Unterdrückung von Oppositionellen einher. Dieses Kontrollsystem überwachte nicht nur Kriminelle, sondern machte auch normale Bürger zu Verdächtigen. Wenn wir etwas aus der deutschen Teilung gelernt haben, dann, dass Massenüberwachung die Redefreiheit und die Demokratie selbst zerstört. Heute wird in Europa ein Vorschlag diskutiert, der die Gefahr birgt, dieselben Fehler zu wiederholen: die sogenannte Chatkontrolle, die derzeit im EU-Rat zur Abstimmung steht. Für jemanden, der sich nicht mit IT und Online-Sicherheit auskennt, mag der Vorschlag zunächst vernünftig klingen: Apps und Dienste sollen gezwungen werden, die Geräte der Nutzer auf Material über sexuellen Kindesmissbrauch zu scannen - um Kinder zu schützen. Aber so harmlos es auch klingen mag, dieses KI-Scanning auf persönlichen Geräten würde die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung untergraben, was die Sicherheit für alle schwächen und die Massenüberwachung zur neuen Norm machen würde; und das in einem Ausmaß, von dem die ostdeutsche Regierung nur hätte träumen können.
Interview zur Chatkontrolle
Über das Thema Chatkontrolle haben wir uns kürzlich mit Matthias Baenz, Anwalt und langjähriger Nutzer von Tuta, unterhalten, der hervorragend erklären kann, wie wir in diese Situation geraten sind und warum sie so schlimm ist. Ein längeres Interview mit Matthias Baenz können Sie hier lesen.
Frage: Denken Sie, dass Politiker das Risiko von Chatkontrolle selbst wirklich verstehen? Immerhin wäre ja auch ihre eigene Kommunikation in dem Moment nicht mehr sicher. Oder glauben Sie, es wird irgendwann zwei Systeme geben - eines für Behörden und eines für den normalen Bürger?
Matthias Baenz: Also, ich habe ehrlich gesagt den Verdacht, dass die meisten Politiker die Sache nicht wirklich zu Ende denken. Ich unterstelle ihnen dabei gar nicht, dass sie es nicht könnten – intellektuell sind die meisten sicher absolut in der Lage, diesen Gedanken weiterzudenken. Aber sie tun es einfach nicht. Sie bleiben oft stehen bei der Frage: Welches Anliegen wollen wir eigentlich verfolgen?
Da fällt dann sofort das Schlagwort „Terrorismusbekämpfung“. Ich nehme das jetzt mal exemplarisch raus. Es geht um innere Sicherheit, äußere Sicherheit, um den Schutz der Bevölkerung, um den Kampf gegen Kindesmissbrauch, all diese Dinge. Das sind ohne Frage sehr wichtige Anliegen. Und diese Anliegen werden selbstverständlich von Politikern erkannt und als wichtig eingeordnet – völlig zu Recht.
Frage: Das heißt, der erste Impuls ist: Das Ziel ist ehrenwert, also machen wir es.
Matthias Baenz: Genau. Das ist der erste Gedankenschritt. Und der zweite ist dann oft: Die Ermittlungsbehörden sagen, sie brauchen das. Sie sagen, ohne diese Maßnahmen kommen wir nicht mehr an die Täter ran, nicht an die Verbrecherbanden, nicht an die Akteure im Hintergrund. Und an dieser Stelle – und das sage ich ausdrücklich, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren – aber an dieser Stelle sagen dann viele Politiker: „Okay, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig.“
Und genau da liegt der Denkfehler. Man zieht aus diesen beiden Punkten – dem berechtigten Anliegen und der Forderung der Behörden – diese eine Schlussfolgerung: Wir müssen das dann eben so machen. Aber diese Schlussfolgerung ist in mehrfacher Hinsicht falsch.
Frage: Inwiefern?
Matthias Baenz: Zum einen gibt es natürlich sehr wohl Alternativen. Es gibt keine Verschlüsselung, die ich nicht auf irgendeinem Wege doch noch brechen oder umgehen könnte. Es gibt immer Möglichkeiten, auch wenn sie schwieriger, aufwendiger oder eben individueller sind. Aber es ist nicht so, dass der Zugriff auf Informationen unmöglich wäre, nur weil man starke Verschlüsselung hat. Es gibt technische und auch ermittlungstaktische Wege.
Und das Zweite – und das ist der eigentlich viel größere Fehler – ist, dass man überhaupt nicht reflektiert, was man damit anrichtet. Man schiebt diese Frage einfach beiseite. Das fällt für mich unter die Rubrik „Der Zweck heiligt die Mittel“. Also: „Es ist jetzt so wichtig, dann muss es eben sein. Dann bleibt uns nichts anderes übrig.“
Aber genau dieser Gedanke ist brandgefährlich. Denn damit macht man sich nicht mehr bewusst, was das für weitreichende Konsequenzen hat – nicht nur für die Kommunikation der Bürger, sondern eben auch für die der Politiker selbst, für Unternehmen, für die gesamte Gesellschaft. Dieses Bewusstsein fehlt oft komplett, weil man sich in dieser alternativlosen Logik gefangen hat: „Wir können ja nicht anders.“
Frage: Also kein böswilliges Kalkül, sondern eher mangelnde Weitsicht?
Matthias Baenz: So würde ich das tatsächlich beschreiben. Es ist nicht Boshaftigkeit. Es ist fehlende Konsequenz im Denken.
Technisch machbar - aber eine sehr dumme Idee
Kurz gesagt, was Matthias Baenz - und auch andere Experten - sagen, ist, dass Chatkontrolle technisch machbar ist, aber eine sehr dumme Idee. Ja, Ingenieure könnten clientseitiges Scannen in verschlüsselte Dienste einbauen. Aber damit würde jedes persönliche Smartphone zu einem Überwachungsgerät, das missbraucht und angegriffen werden kann. Sobald die Verschlüsselung geschwächt ist, ist sie für alle geschwächt - nicht nur für Kriminelle.
Was ist mit politischem Missbrauch?
Das Beispiel Ostdeutschland hat gezeigt, dass sich jedes Überwachungsinstrument recht einfach gegen die eigenen Bürger eines Landes wenden lässt. Dies ist vielleicht das größte Risiko von Chatkontrolle: Wer kann garantieren, dass dieses System - wenn es denn existiert - nicht missbraucht wird? Wer kann garantieren, dass die politischen Führer dieses System nicht zur Überwachung und Unterdrückung ihrer Opposition nutzen werden?
Keiner. Sobald die technische Methode zur Überwachung der Bürger vorhanden ist, kann sie gegen sie eingesetzt werden.
Genau das war in Ostdeutschland der Fall: Die Überwachung ging weit über “ernsthafte Bedrohungen” hinaus und wurde zu einem Instrument, um politische Gegner zu überwachen, einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen.
Am Tag der Deutschen Einheit darf diese Lektion nicht vergessen werden.
Warnung aus der Geschichte
Der Tag der Deutschen Einheit ist ein Tag zum Feiern, aber auch ein Tag zum Erinnern. Es geht darum, sich daran zu erinnern, was wir überwunden haben: Massenüberwachung, Angst und die Unterdrückung von Opposition. Es geht darum, sich daran zu erinnern, dass Freiheit und Privatsphäre zerbrechlich sind und verteidigt werden müssen.
Chatkontrolle droht uns nicht vorwärts, sondern rückwärts zu bringen.
Die Botschaft von Tuta ist klar: Wir werden uns gegen die gesetzliche Verpflichtung wehren, Überwachung in unsere Dienste einzubauen. Lasst uns am Tag der Deutschen Einheit die Freiheit feiern und uns daran erinnern, warum wir “Nein” zu Chatkontrolle sagen müssen.